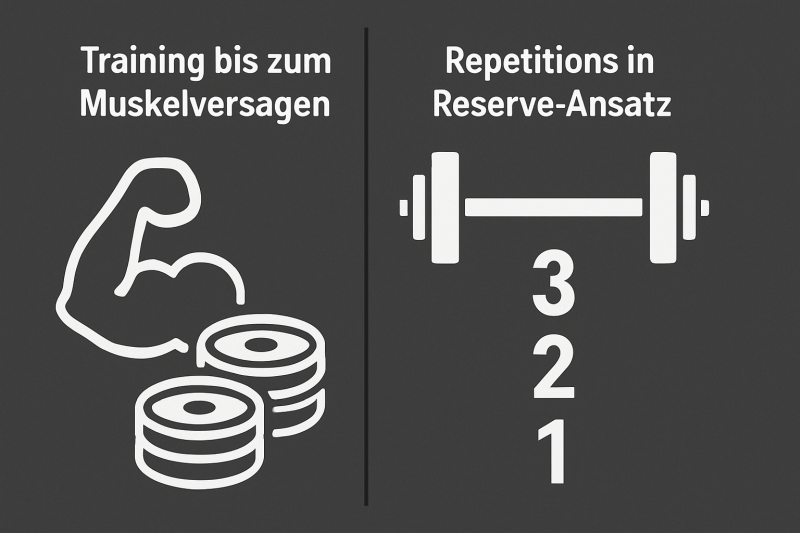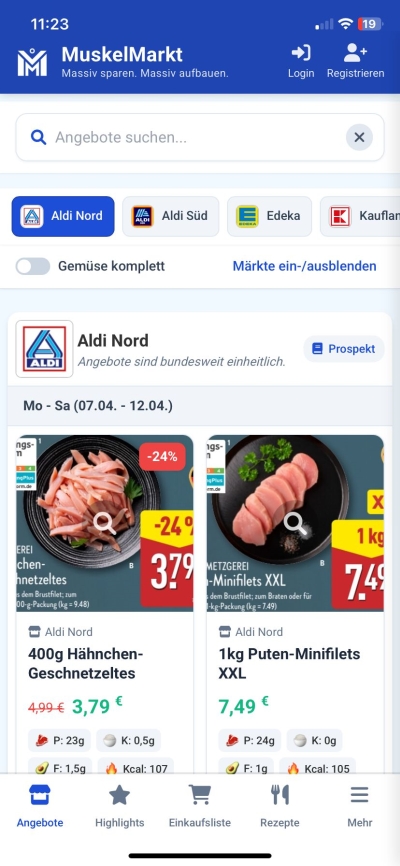In diesem Artikel betrachten wir die Unterschiede zwischen Training bis zum echten Versagen und dem RIR-Ansatz auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei beleuchten wir die Auswirkungen auf Muskelaufbau (Hypertrophie) und Maximalkraft, diskutieren Unterschiede für Anfänger und Fortgeschrittene und geben praktische Empfehlungen in neutraler, wissenschaftlich fundierter Sprache.
Was bedeutet „Training bis zum Versagen“ und was ist RIR?
Training bis zum (Muskel-)Versagen bedeutet, dass ein Satz so lange ausgeführt wird, bis keine weitere Wiederholung mit korrekter Technik geschafft werden kann. Das heißt, der Muskel wird in diesem Satz maximal ausgelastet – weiter geht es schlicht nicht. Dieser intensive Ansatz führt dazu, dass alle verfügbaren Muskelfasern rekrutiert werden müssen, um die Übung bis zur völligen Ermüdung auszuführen.
Im Gegensatz dazu endet man beim RIR-Ansatz einen Satz bevor das absolute Versagen erreicht ist, nämlich mit einigen „Wiederholungen in Reserve“. Zum Beispiel bedeutet 2 RIR, dass man den Satz stoppt, obwohl man schätzungsweise noch 2 weitere saubere Wiederholungen hätte ausführen können. Oft wird empfohlen, im Bereich von etwa 1–3 RIR zu trainieren. Beide Methoden haben in der Praxis ihren Platz und können zu Muskel- und Kraftzuwächsen führen. Wie unterscheiden sie sich nun konkret in ihren Auswirkungen?
Auswirkung auf Muskelaufbau (Hypertrophie)
Ein zentrales Ziel des Krafttrainings ist häufig die Hypertrophie, also das Muskelwachstum. Lange Zeit wurde angenommen, nur Sätze bis zum völligen Muskelversagen würden den maximalen Wachstumsreiz bieten. Neuere Studien stellen dieses Dogma jedoch infrage. Eine Meta-Analyse von 15 Studien fand keinen signifikanten Unterschied im Muskelzuwachs, ob Probanden bis zum Muskelversagen oder mit einer Reserve an Wiederholungen trainierten1. Anders ausgedrückt: Solange nahe ans Versagen herangetragen wird (bis auf wenige Wiederholungen Abstand), waren die Zuwächse in der Muskelmasse statistisch ähnlich.
Diese Erkenntnis wurde durch aktuelle Einzelstudien untermauert. In einer 8-wöchigen Studie mit fortgeschrittenen Kraftsportlern wurde beispielsweise ein Bein der Probanden bei Beinpressen und Beinstrecker bis zum Muskelversagen trainiert, während das andere Bein mit etwa 1–2 Wdh. „im Tank“ beendet wurde. Das Ergebnis: Beide Beine zeigten nahezu identische Zuwächse im Muskelquerschnitt – sprich, der Hypertrophie-Effekt war mit RIR ebenso groß wie mit Training bis zum Versagen2. Entscheidend ist offenbar, dass die Sätze ausreichend nahe an die Ermüdungsgrenze gebracht werden (etwa innerhalb von 0–3 Wiederholungen vom Versagen), um alle motorischen Einheiten und Muskelfasern zu aktivieren. Wird dieses intensive Reizniveau erreicht, scheint das letzte Quäntchen bis zum totalen Versagen für den Muskelaufbau keinen zusätzlichen Vorteil zu bringen.
Allerdings sollte man beachten, dass sehr „lockeres“ Training mit zu großer Reserve (z.B. >5 Wiederholungen übrig) für optimalen Muskelaufbau nicht ausreicht – insbesondere bei Fortgeschrittenen. Studien mit untrainierten Probanden zeigten hingegen, dass bereits moderat intensive Sätze (z.B. ~4–5 RIR) gepaart mit etwas höherem Volumen deutliche Muskelzuwächse erzielen können. Anfänger erzielen schon mit weniger Intensität Zuwächse, weil ihr Körper noch sehr empfindlich auf neue Trainingsreize reagiert. Mit steigender Trainingserfahrung wird es jedoch wichtiger, zumindest nahe ans Versagen zu gehen, um einen ausreichend starken Wachstumsreiz zu setzen.
Fazit für Hypertrophie: Sätze bis zum echten Muskelversagen bieten keinen pauschalen Hypertrophie-Vorteil gegenüber Sätzen, die kurz vor dem Versagen beendet werden. Entscheidend ist, dass pro Satz genügend nahe an die Belastungsgrenze gegangen wird. Ein bis drei Wiederholungen vor dem Versagen zu stoppen, reicht in der Regel aus, um maximale Muskelreize zu setzen – ohne die muskuläre Erschöpfung unnötig in die Höhe zu treiben.
Auswirkung auf Kraft und Leistungsfähigkeit
Für Maximalkraft und Kraftzuwächse ist das Bild ähnlich: Absolutes Muskelversagen in jedem Satz ist nicht notwendig, um stärker zu werden. Laut der genannten Meta-Analyse waren die Kraftzuwächse bei Versagen-Training und Nicht-Versagen-Training ebenfalls vergleichbar1. Interessanterweise zeigten einige Untersuchungen sogar leicht höhere Kraftsteigerungen, wenn nicht bis zum letzten möglichen Wiederholung gegangen wurde – insbesondere in Fällen, in denen die nicht-versagende Gruppe dadurch mehr Gesamtvolumen oder schwerere Gewichte bewältigen konnte. Der Grund: Wer sich nicht in jedem Satz komplett verausgabt, kann oft mehr Gesamtleistung im Training erbringen (z.B. zusätzliche Sätze oder Wiederholungen, höhere Lasten) und erholt sich schneller zwischen den Sätzen. Dies kommt den Kraftzuwächsen zugute.
Zudem spielt bei Krafttraining die Technik und neuronale Anpassung eine große Rolle. Beim Training mit extrem hoher Ermüdung (durch Versagen) kann die Ausführung der letzten Wiederholungen unsauber werden, was gerade bei komplexen Grundübungen kontraproduktiv sein kann. Powerlifter und Gewichtheber etwa nutzen häufig submaximale Lasten und beenden Sätze mit ein paar Wiederholungen Reserve, um genug Stimulus für Kraft zu setzen, ohne in jeder Einheit ans Limit zu gehen. So können sie die Hebe-Technik sauber halten und häufiger oder mit höherem Gesamtumfang trainieren.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Maximalkraft profitiert nicht davon, jeden Satz bis zum bitteren Ende auszureizen. Im Gegenteil – wer immer bis zum Versagen trainiert, riskiert unnötige Ermüdung des zentralen Nervensystems und verlängert seine Regenerationszeit, ohne dass die Kraftsteigerung dadurch höher ausfällt. Ein kontrolliertes Training mit etwas Puffer (z.B. 1–3 RIR) erlaubt meist einen effizienteren Kraftaufbau, solange die Intensität (Gewicht) grundsätzlich hoch genug gewählt ist.
Neuromuskuläre Ermüdung und Regeneration
Ein wichtiger Unterschied zwischen den Ansätzen liegt in der akuten Ermüdung und der erforderlichen Regenerationszeit. Training bis zum vollständigen Muskelversagen bringt eine sehr hohe neuromuskuläre Belastung mit sich: Alle Muskelfasern werden ausgereizt, das zentrale Nervensystem wird stark beansprucht, und es kommt zu einer ausgeprägten Ausschöpfung der kurzfristigen Energiespeicher. Entsprechend fällt die Ermüdung nach einem Satz bis zum Versagen deutlich größer aus als nach einem Satz mit z.B. 2 Wiederholungen Reserve2. Praktisch bedeutet das: Wer viele Sätze bis ans Limit trainiert, benötigt längere Pausen zwischen den Sätzen und oft auch mehr Erholungstage nach der Einheit, um vollständig zu regenerieren.
Der RIR-Ansatz hingegen zielt darauf ab, einen Großteil des Trainingsreizes mitzunehmen, ohne den Körper jedes Mal in die absolute Erschöpfung zu treiben. Durch dieses „Temperieren“ der Satzintensität bleibt die kumulative Ermüdung pro Trainingseinheit moderater. Athleten können dadurch unter Umständen mehr Gesamtvolumen pro Woche bewältigen oder Muskelgruppen häufiger trainieren, weil die einzelne Einheit sie weniger „auslaugt“. Gerade bei fortgeschrittenen Athleten kann dies hilfreich sein, da hier das Trainingsvolumen ein wichtiger Faktor für Fortschritt ist.
Allerdings sollte man auch nicht vergessen, dass der Körper sich anpassen kann: Wer regelmäßig nahe am Versagen trainiert, entwickelt mit der Zeit eine höhere Ermüdungsresistenz. Das heißt, die akute Erschöpfung pro Satz kann langfristig etwas geringer ausfallen, wenn der Körper sich an das harte Training gewöhnt. Nichtsdestotrotz bleibt das Grundprinzip bestehen: Training bis zum Versagen ist ein zweischneidiges Schwert – es garantiert maximalen Reiz pro Satz, aber erkauft diesen mit sehr viel Müdigkeit, die gemanagt werden muss.
Anfänger vs. Fortgeschrittene: Welche Intensität für wen?
Die Trainingsplanung sollte immer den Erfahrungsgrad des Sportlers berücksichtigen. Anfänger profitieren in der Regel nicht davon, jeden Satz bis zum absoluten Versagen zu gehen. Ihr Körper reagiert schon auf weit geringere Reize mit Anpassungen. Oft fehlt Einsteigern auch noch das Gefühl für die eigene Leistungsgrenze und die Technik leidet, wenn sie zu verbissen an die letzte Wiederholung gehen. Für sie ist es meist sinnvoller, mit einigen Wiederholungen Puffer zu trainieren, saubere Bewegungsabläufe zu erlernen und schrittweise das Kraftniveau zu steigern. So erzielen sie sehr gute Fortschritte, ohne sich übermäßig zu erschöpfen oder Verletzungen zu riskieren.
Fortgeschrittene Athleten hingegen nähern sich in ihrem Training oft stärker dem Muskelversagen an, da ihr Körper an Training gewöhnt ist und ein größerer Reiz nötig wird, um weitere Anpassungen zu stimulieren. Studien deuten darauf hin, dass bei sehr gut Trainierten ein kleiner Vorteil für Hypertrophie bestehen kann, wenn phasenweise bis ans Muskelversagen trainiert wird1. Dennoch sollten auch Fortgeschrittene vorsichtig planen: Ständig 100% Intensität zu fahren, kann schnell zu Überlastung führen. Ein periodisiertes Vorgehen bietet sich an – z.B. in einigen Wochen näher ans Versagen gehen, gefolgt von leichteren Wochen (Deloads) zur Erholung. Fortgeschrittene können außerdem unterschiedliche Übungen unterschiedlich intensiv trainieren: Bei isolierten Übungen (z.B. Bizepscurls, Seitenheben) lässt sich ein Satz bis zum Versagen relativ sicher ausführen; bei technisch anspruchsvollen Grundübungen (Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken) ist es oft besser, 1–2 Wdh. in Reserve zu lassen oder einen Spotter zur Sicherheit dabei zu haben.
Der Knackpunkt RIR: Selbstüberschätzung vermeiden
Der RIR-Ansatz steht und fällt mit der Fähigkeit des Trainierenden, die eigene Leistungsgrenze realistisch einzuschätzen. Und genau hier lauert bei vielen ein Problem: Trainierende schätzen ihren „Tank“ oft falsch ein. Gerade weniger Erfahrene glauben zum Beispiel, dass nur noch 1–2 Wiederholungen möglich sind, brechen den Satz ab – obwohl in Wirklichkeit vielleicht noch 5 oder mehr Wiederholungen machbar gewesen wären4. Solche Fehleinschätzungen führen natürlich dazu, dass der effektive Trainingsreiz geringer ausfällt als geplant. Der Muskel wird dann gar nicht erst in die Nähe der erforderlichen Ermüdung gebracht, um maximale Fortschritte anzustoßen.
Wie kann man dem entgegenwirken? Erstens sollte man als Anfänger lernen, was echtes Muskelversagen überhaupt bedeutet. Es kann sinnvoll sein, ab und zu einen Satz unter Aufsicht wirklich bis zum Geht-nicht-mehr zu absolvieren – sei es bei einer geführten Maschine oder mit einem erfahrenen Trainingspartner als Spotter. Dieses „Herantasten“ hilft, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich die letzten möglichen Wiederholungen anfühlen. Zweitens empfiehlt es sich, ein Trainingslogbuch zu führen. Wer seine Leistungen notiert, kann besser abschätzen, ob er sich tatsächlich gesteigert hat und wie knapp er bei vorherigen Sätzen vor dem Versagen war. Drittens: Im Zweifelsfall lieber etwas härter pushen. Wenn man unsicher ist, ob noch eine Wiederholung drin gewesen wäre, kann es strategisch sinnvoll sein, gelegentlich doch eine zusätzliche (ggf. fordernde) Wiederholung zu machen, um sicher im effektiven Intensitätsbereich zu bleiben.
Fazit: Welcher Ansatz ist besser?
Sowohl das Training bis zum Muskelversagen als auch der RIR-Ansatz haben ihre Berechtigung im Kraftsport. Die Wissenschaft zeigt klar, dass man für Muskelaufbau und Kraftzuwächse nicht zwangsweise jeden Satz bis zum letzten Ausbrennen treiben muss – vergleichbare Erfolge lassen sich auch erzielen, wenn man ein bis zwei Wiederholungen vor dem Versagen stoppt12. Der entscheidende Faktor ist, dass die Übung mit ausreichend hoher Anstrengung ausgeführt wird, um einen Trainingsreiz zu setzen. In der Praxis bietet es sich an, die beiden Methoden gezielt zu kombinieren:
Training bis zum Versagen – gezielt und mit Bedacht: Diese Methode kann eingesetzt werden, um die persönlichen Grenzen kennenzulernen und bei fortgeschrittenen Athleten hin und wieder einen maximalen Reiz zu setzen (z.B. am Ende eines Trainingszyklus oder bei einzelnen Isolationsübungen). Ein Satz bis zum Versagen garantiert die vollständige Rekrutierung aller Muskelfasern und kann mental dabei helfen, die eigene Belastbarkeit auszuloten. Allerdings sollte man sie sparsam einsetzen – vor allem bei komplexen Grundübungen – da sie sehr ermüdend ist und ein höheres Verletzungsrisiko mit sich bringt. Dauerhaft jeden Satz bis zum Limit zu treiben, birgt die Gefahr von Übertraining und Verletzungen3.
RIR-Ansatz – effizient und nachhaltig: Die Mehrheit des Trainings kann mit einigen Wiederholungen in Reserve gestaltet werden. So erzielt man über längere Zeiträume einen hohen Trainingsumfang, ohne sich ständig „kaputt“ zu machen. RIR erfordert zwar etwas Übung in der Selbsteinschätzung, gewährleistet aber langfristig oft konstantere Fortschritte, da die Balance zwischen Belastung und Erholung gewahrt bleibt. Wichtig ist, den RIR korrekt zu wählen – für optimalen Muskelaufbau meist im Bereich 0–3 RIR. Ist man sich unsicher, lieber etwas weniger Reserve lassen. Wer den RIR-Ansatz meistert, kann damit sehr effektiv trainieren und die gleichen Erfolge erzielen wie mit Versagens-Training – mit weniger Verschleiß für Körper und Geist4.
Abschließend lässt sich sagen: Die „goldene Mitte“ aus hartem, aber intelligentem Training ist oft der Königsweg. Wer immer ohne Rücksicht auf Verluste bis ans Limit geht, riskiert unnötig seine Gesundheit und stagnierende Fortschritte3. Wer hingegen zu vorsichtig trainiert und stets viele Wiederholungen übrig lässt, schöpft sein Potenzial nicht aus. Die besten Erfolge erzielen Kraftsportler erfahrungsgemäß, wenn sie hart trainieren, aber nicht jeden Satz überreizen – sprich, mit hoher Intensität und kluger Einteilung der Kräfte. So werden Muskeln und Kraft kontinuierlich gesteigert, während Überlastungen vermieden werden. Trainiere smart: Fordere dich – aber zerstöre dich nicht in jedem Satz. Dann profitierst du langfristig am meisten von deinem Training.
Quellenverzeichnis
- 1 Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysishttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9068575/
- 2 Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resistance-trained individualshttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38393985/
- 3 Die Wissenschaft vom Muskelversagen (und ein kritischer Tipp für Dein Training)https://www.marathonfitness.de/muskelversagen/
- 4 Training bis Muskelversagen vs. RIR: Was ist besser?https://www.onifit.de/krafttraining/muskelversagen-vs-rir